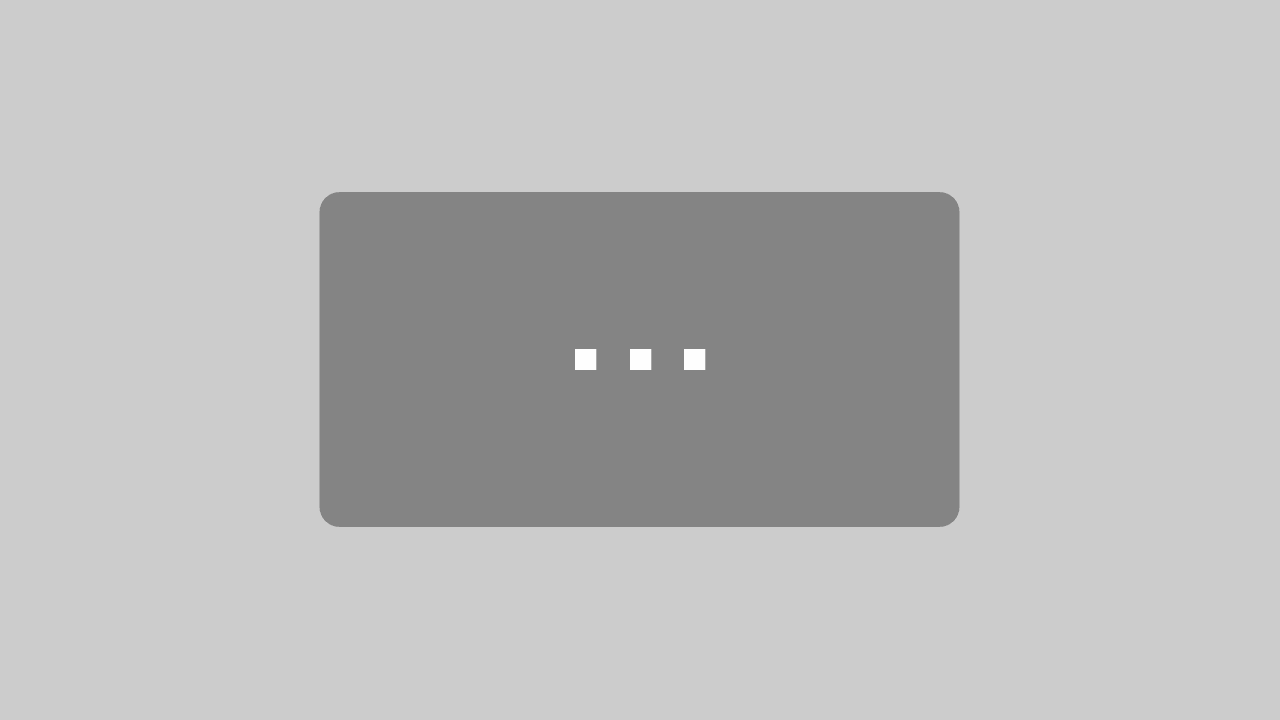Mitschnitt des Fachgesprächs der EFiD
Der Einladung zum digitalen Podium „Können Menschen mit Penis Frauen sein?“ waren am 8. September 2021 mehr als 40 Interessierte gefolgt, sodass sich moderiert von Frauke Petersen eine rege Diskussion entwickelte. Ein kuratierter Mitschnitt der Veranstaltung ist auf YouTube verfügbar unter: youtu.be/H2EgV4Vk-cI
Die Referate:
Zu den Facetten des Begriffs Gender gab Prof. Dr. Paula-Irene Villa Braslavsky, Genderforscherin an der LMU München eine Einführung. Prof. Dr. Konstanze Plett, Juristin an der Uni Bremen skizzierte Stationen der historisch-rechtlichen Kontextualisierung des sog. Transsexuellengesetzes (TSG). Elke Spörkel, Pfarrerin und Beraterin sprach zum Thema „Transidentität, Theologie und Kirche“ und berichtete von Erfahrungswerten zum Umgang von Kirchgemeinde und Landeskirche mit Transition. Dr. Antje Schrupp (Politikwissenschaftlerin) beschrieb unter dem Titel „Schwangerwerdenkönnen“ Geschlechterdifferenz entlang der reproduktiven Fähigkeiten und stellte eine Binarität zur Diskussion, die von Menschen mit und Menschen ohne Uterus spricht.
Die Diskussion:
Die Diskussion wurde vielschichtig und engagiert geführt. Für das Nachdenken über die bedingte Verfügbarkeit und Deutungshoheit über Körper und Geschlecht war ebenso Raum, wie der Austausch von Argumenten zur Notwendigkeit und zum konkreten Nutzen des Geschlechtseintrags im Geburtenregister. Die Frage, inwiefern geschlechtsspezifische Schutzräume für transidente Personen zugänglich sein sollten, wurde mit dem Hinweis auf den Bedarf nach je eigenen Schutzräumen für transidente Personen beantwortet. Der Nachholbedarf kirchlicher Einrichtungen hinsichtlich der Sensibilisierung im Umgang mit trans* Personen wurde benannt. Ebenso sei das Angebotsspektrum mindestens im Bereich der Rituale und Seelsorge ausbaufähig. Ein Exkurs zu Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin offenbarte ferner den umfangreichen rechtlichen Regelungsbedarf von Elternschaft sowie die Notwendigkeit eine neue Ethik der Elternschaft zu erarbeiten.
Dokumentation „Können Menschen mit Penis Frauen sein?“ Zum Zusammenhang von Körper und Geschlecht
Zur Frage „Können Menschen mit Penis Frauen sein?“ fand am 8. September 2021 ein digitales Podium der Evangelischen Frauen in Deutschland statt. Der Einladung waren mehr
als 40 Interessierte gefolgt, sodass sich eine rege Diskussion entwickelte. Ein kuratierter Mitschnitt der Veranstaltung ist online verfügbar unter:
Hintergrund und Form
Im Vorfeld der Veranstaltung waren aus den Mitgliedorganisationen der EFiD vermehrt Anfragen zur Bedeutung des Transsexuellengesetzes (TSG) für geschlechtsspezifische Arbeit formuliert worden – etwa die befürchtete Gefährdung frauenspezifischer Schutzräume durch trans* Frauen sowie der Einfluss reproduktiver Voraussetzungen bei der Verhältnisbestimmung von Körper und Geschlecht. Die Themenfelder Transidentität, Geschlechterdifferenz und Gender wurden von vier Expert*innen aus soziologischer, juristischer, theologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive entfaltet. Jedem Referat folgte eine Rückfragerunde, ein unmoderierter Austausch in Kleingruppen und ein erneutes Gespräch im Plenum.
Die Expert*innen und ihre Schwerpunkte
Prof. Dr. Paula-Irene Villa Braslavsky (Genderforscherin, LMU München) legte eine theoretische Grundlage, indem sie einführend die vielen Facetten Begriffs „Gender“ beschrieb. Das Unbehagen in Bezug auf die Verhandelbarkeit von Geschlechtlichkeit betreffe Menschen verschiedener Milieus und politischer Konstellationen, so ihre Beobachtung. Dieses Unbehagen sei in der Vervielfältigung der Sichtbarkeit von Geschlechtern begründet, weil damit Verunsicherung, Unklarheit und Unplanbarkeit von Prozessen einhergehe. Die Optimierung der eigenen Geschlechtlichkeit komme nun im Anspruch der beständigen Selbstoptimierung als Aufgabenfeld hinzu. Villa nennt dies „Rohstoffisierung des Körpers“, d.h. den Körper als bearbeitbaren, veränderbaren Rohstoff zu verstehen. Sie sieht dadurch das Konzept einer unverfügbaren Natürlichkeit, auf dem die Rede von der unveränderlichen Zweiwertigkeit der Geschlechter, der Heteronormativität gründet, abgelöst. Den begrenzten Fokus auf das individuelle Geschlechtsempfinden beurteilte sie kritisch und wies auf die zu jederzeit nur bedingte Verfügbarkeit der Geschlechtlichkeit hin. Ebenso wie die Fragen nach Macht und Deutungshoheiten müsste die Frage nach der Zugänglichkeit geschlechtsspezifischer Räume immer neu verhandelt werden. Villa räumte ein, dass in der Praxis die Ambivalenzen der Geschlechtlichkeit sowohl Anlässe für Demütigung und Gewalt böten, ebenso aber auch Quelle der Lust und des Empowerments sein könnten und führte dies an Beispielen aus.
Prof. Dr. Konstanze Plett (Juristin, Uni Bremen) skizzierte Stationen der historisch-rechtlichen Kontextualisierung des Transsexuellengesetzes (TSG). In Deutschland führten seit Ende des 19. Jh. Standesämter amtlich Buch über Neugeborene inklusive Geschlechtseintrag. Dieser Eintrag habe als unveränderliches Merkmal gegolten und sei anhand der äußeren Geschlechtsmerkmale festgestellt worden. Gelegentlich seien Fälle einer erfolgreichen Änderung des Geschlechtseintrags dokumentiert, die jedoch bis in die 1970er-Jahre hinein erforderten, dass Betroffene die Fehlerhaftigkeit des ursprünglichenEintrags nachweisen konnten. Das 1980 verabschiedete Transsexuellengesetz habe sich insofern weiterentwickelt, dass manche Voraussetzungen für Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags mit der Zeit wegfielen, wie etwa der Nachweis angleichender Operationen, der Unfruchtbarkeit oder der Ehelosigkeit. Aktuell seien zwei voneinander unabhängige Gutachten und ein Gerichtsbeschluss erforderlich, um eine Eintragsänderung zu erwirken. Zur Frage nach der Bedeutung des TSG für die Frauenbewegung merkte Plett an, dass auch mit der formalen Anerkennung verschiedener Geschlechtsidentitäten die Diskriminierung von Frauen nicht aufgehört habe. In der Vergangenheit habe der Geschlechtseintrag im Geburtenregister sich als nützlich für die Erhebung und den Nachweis geschlechtsspezifischer Diskriminierung erwiesen. Um etwa geschlechtsspezifische Arbeits- oder Gesundheitsschutzmaßnahmen aufrecht zu erhalten, bedürfe es nach Pletts Meinung keines Registereintrags, sondern es müsse ohnehin fortwährend daran gearbeitet werden, dass Gesetzgebung dazu beiträgt, Geschlechtsdiskriminierung zu minimieren. Plett kritisierte das öffentliche Framing, die Gewährung von Rechten an Menschen bedeute automatisch, dass andere Rechte einbüßen müssten und warb für eine andere Sicht: Die Mehrung von Rechten sei eine win-win-Situation.
Elke Spörkel (Pfarrerin, Beraterin und spokes person für transidente Personen) sprach zum Thema „Transidentität, Theologie und Kirche“. Laut biblischer Überlieferung sei der Mensch männlich und weiblich geschaffen, woraus Spörkel ableitete, dass es hier nicht um ein „Entweder-oder“ der Geschlechter gehe. Ihr Erfahrungsbericht machte deutlich, dass insbesondere der kirchliche Umgang mit Transidentität noch Defizite aufweist. Hier komme es vor allem auf die Fähigkeit der Leitungspersonen an, den Spagat zwischen Außenrepräsentation und Leitung nach innen zu schaffen. Die Bandbreite an Gefährdungen transidenter Menschen sei weit und reiche von Kontaktabbruch über Arbeitsplatzverlust bis hin zu körperlicher Gewalterfahrung und Bedrohung des Lebens. Kirche sollte auf Seiten der Schwachen sein, so Spörkel und in ihren Kernbereichen Seelsorge und Beratung Unterstützungsangebote entwickeln. Dabei sei keineswegs damit zu rechnen, dass transidente Menschen etwa die Frauenberatungsstellen stürmen könnten, sondern es gehe hier um ein spezifisches eigenes Angebot, für das Bedarf bestehe. Auch im Bereich der Predigt würden Rituale nachgefragt. Mit einem Segnungsangebot anlässlich einer Namens- und Personenstandsänderung mache sie sehr gute Erfahrungen. Dennoch gebe es Leerstellen im Bereich von Arbeitsmaterialien sowie in der Sensibilisierung kirchlicher Angestellter. Es brauche starke Netzwerke. Sie halte Transidentität für einen Prüfstein für Kirche und Gesellschaft, ob sie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ernst nimmt.
Dr. Antje Schrupp (Politikwissenschaftlerin und Mitglied des EFiD-Präsidiums) gab Impulse aus ihrem Buch „Schwangerwerdenkönnen“. Sie plädierte generell für die Entwicklung neuer Narrative, wie über Reproduktion gesprochen wird. So entstamme etwa die Rede von „Sperma“, also „Samen“ einem patriarchalen Konzept Aristoteles‘ der – nichts von Eizellen wissend – den weiblichen Körper lediglich als passives Gefäß degradierte, in dem der männliche Same wachsen könne. Biologisch korrekt sei jedoch von männlichen Pollen zu sprechen. Geschlechterdifferenz beschrieb Schrupp entlang der reproduktiven Fähigkeiten und stellte insofern eine Binarität zur Diskussion, die von Menschen mit und Menschen ohne Uterus spricht. Während Hormonstatus, Genitalien und Chromosomen und erst recht Kleidung, Verhalten und Sozialisation vielfältige Zwischenformen aufwiesen, die die klare Zuordnung zur binären Geschlechtersystematik erschwerten oder unmöglich machten, stelle der Besitz oder Nicht-Besitz einer Gebärmutter ein eindeutiges, wenn auch nicht äußerlich sichtbares Merkmal dar. Daraus folge die Notwendigkeit für Menschen mit Uterus, sich im Laufe des Lebens mit der Möglichkeit einer Schwangerschaft auseinanderzusetzen, während den anderen diese Frage erspart bliebe. Hinzu komme die seit dem römischen Recht explizit an Mutterschaft gebundene Pflicht, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Dabei sei Elternschaft, sofern damit die Übernahme von Verantwortung für den Nachwuchs gemeint ist, von biologischen Voraussetzungen unabhängig. In Bezug auf Elternschaft gebe es aktuell und künftig einen enormen rechtlichen Regelungsbedarf im Zuge der Entwicklungen der Reproduktionsmedizin, Leihmutterschaft und der Diversifizierung von Familienkonstellationen.
Gesprächsfäden im Plenum (Beispiele)
In der sich an Schrupps Vortrag anschließenden Diskussion machte Plett deutlich, dass die reproduktionstechnischen Möglichkeiten aktuell den Druck auf Frauen erhöhten, ihrer vermeintlich natürlichen Aufgabe“ des Gebärens nachzukommen oder sich mindestens für Kinderlosigkeit zu rechtfertigen. Repro-Medizin werde nicht in freiheitlichem Sinn zugunsten der Pluralisierung von amilienformen eingesetzt, sondern genutzt, um heteronormative Natürlichkeit zu simulieren, indem manchen Paaren Schwangerschaft aufgedrängt, manchen Personen Reproduktionstechnik orenthalten werde. Interessanterweise bestehe die Utopie nicht darin, dass niemand mehr schwanger sein muss, sondern dass alle schwanger werden können, so Schrupp. Klare feministische ositionierungen dazu fehlten. An anderer Stelle wurde die Frage nach Macht und Zwang gestellt. Villa hielt ein eindringliches Plädoyer für Grenzen und Entlastung. Transidente Personen dürften nicht verpflichtet sein, sich ständig erklären zu müssen. Darüber hinaus sei nicht jeder Mensch gleichermaßen gezwungen, sich mit der eigenen Geschlechtlichkeit auseinanderzusetzen. Manche könnten sich dem Thema entziehen ohne Nachteile befürchten zu müssen und laugten durch ihre Haltung des Nicht-Verstehen-Wollens den Diskurs aus. Schrupp ergänzt, hinzu komme der historisch ewordene politische Dissens im Diskurs über Geschlecht, nämlich dass Frausein nicht etwa freiheitlich zu definieren wäre, sondern als Äquivalent und stets bezogen auf das Mannsein. Klare Positionen dazu, ob die Bedrohung der Frauenschutzräume real sei, wurden ebenfalls formuliert: „Wir werden so oder so gelesen.“ beschrieb Plett die Unmöglichkeit sich einer Geschlechtszuschreibung zu entziehen. Auch ohne Geschlechtseintrag würde es zweifellos weiterhin Frauenhäuser geben und mit Blick auf intersektionale Problemlagen seien ohnehin diversifizierte Lösungswege zu suchen, so die Expertin. Es gebe ferner kein beobachtbares Eindringen in Frauenschutzräume durch trans* Frauen, lautete eine Ergänzung aus dem Publikum mit Blick auf die rfahrungen in anderen europäischen Ländern mit Selbstbestimmungsgesetz wie Malta, Dänemark, den Niederlanden oder Irland. Diese Befürchtung diene lediglich dazu, das Selbstbestimmungsgesetz zu torpedieren. Weshalb sie dennoch im deutschsprachigen Diskurs prävalent ist, blieb eine offene Frage, zumal mehr als deutlich wurde, dass trans* Frauen eigener Räume und Rituale bedürfen und diese auch wünschen. Darauf mit spezifischen Angeboten einzugehen, ist eine aktuelle Herausforderung auch für kirchliche Einrichtungen und Personen.
//Zusammenfassung: fp&roj